Der DsiN-Sicherheitsindex, der seit 2014 jährlich die digitale Sicherheitslage von Verbraucher*innen in Deutschland einschätzt, erreichte 2023 einen neuen Tiefstwert von 57,2 von 100 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies ganze 2,6 Punkte weniger. Der Wert nähert sich damit mehr dem kritischen Wert von 50 Punkten an, ab welchem eine Bedrohungslage für Internetnutzer*innen entsteht.
Der DsiN-Sicherheitsindex wird von dem Deutschland sicher im Netz e. V. durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Die Studie betont, wie wichtig die Rolle des Staates und der einzelnen Anbieter, aber auch insbesondere von Schulen und Bildungsinstitutionen, bei der Gewährleistung von und Aufklärung über Sicherheit im Internet ist.
Im vergangenen Jahr verzeichnete der DsiN-Sicherheitsindex eine erheblich gestiegene Anzahl an Sicherheitsvorfällen im Internet. Wie schon im Vorjahr kam es dabei besonders häufig zu Phishing-Versuchen, die zumeist per SMS oder über Messenger stattfanden. 28,3% aller Nutzer*innen berichteten auch davon, infizierte E-Mails, Anhänge oder Weblinks erhalten zu haben. Viele wurden zudem Opfer von Betrug, besonders bei Online-Einkäufen oder -Buchungen. Auch die Anzahl an Datenlecks bei Anbietern digitaler Dienste ist mit 4,2% stark gestiegen.
Trotz der erhöhten Sicherheitsvorfälle hat sich das Versicherungsgefühl der Nutzer*innen aber um 6,9 Punkte verringert — trotz der gestiegenen Gefahr fühlen sich Nutzer*innen also dennoch immer sicherer im Internet. Nutzer*innen legten dafür zwar mehr Sicherheitswissen und ein stärker ausgeprägtes Sicherheitsverhalten an den Tag, jedoch ist der Anstieg in beiden Kategorien nicht signifikant genug, um mit den rapide zunehmenden Sicherheitsvorfällen mitzuhalten. Zudem zeigt sich eine Wissens-Verhaltens-Lücke auf: obwohl das Sicherheitswissen mit 90,5 Punkten sehr hoch ist, wird das erworbene Wissen nicht ausreichend in konkrete Verhaltensänderungen umgesetzt. Das Aneignen von Wissen allein reicht demnach nicht, um sich in der Praxis besser online zu schützen. Um dieses digitale Sicherheitsgefälle abzubauen, ist somit eine verstärkte, praxisbezogenere digitale Aufklärung erforderlich.
Die Ergebnisse des DsiN-Sicherheitsindex verdeutlichen die Bedürfnisse der Nutzer*innen in Bezug auf IT-Sicherheit. Viele wünschen sich eine stärkere Regulierung durch den Staat, zum Beispiel durch die konsequentere Verfolgung von Gesetzesverstößen, strengere Gesetze oder eine zentrale Beratungsstelle. Auch Anbieter sollten laut Nutzer*innen aktiver werden, indem sie ihre Dienste, Programme und Geräte sicherer gestalten und Sicherheitseinstellungen leichter aufzufinden und zu bedienen machen.
Doch am stärksten wurde der Wunsch nach zugänglicheren und stärker gebündelten Informationen zu möglichen IT-Risiken geäußert. Diese sollen verständlicher und unterhaltsamer gestaltet werden und einfache Anleitungen und Praxistipps beinhalten, die anhand alltagsbezogener Beispiele illustriert werden sollen. Drei Viertel aller Befragten wünschen sich zudem noch die frühzeitige Vermittlung von IT-Sicherheit in der Schule, welche später durch weitere schulische oder berufliche Aus- und Weiterbildungen, Workshops oder Informationsveranstaltungen vertieft werden soll.
Angesichts dieser Ergebnisse wird deutlich, dass viele Verbraucher*innen Schulen eine Schlüsselrolle bei der Förderung von IT-Sicherheit zuschreiben. Damit diese Kompetenzen wirksam vermitteln können, ist es jedoch wichtig, dass sie Zugang zu Informationen und Unterrichtsmaterialien haben, die leicht verständlich sind und mit für Schüler*innen relevanten Beispielen arbeiten. Ein Beispiel für solche Unterrichtsmaterialien wäre die Unterrichtseinheit „Jugendliche online“ von Medien in die Schule, welche Jugendlichen die Bedeutung von Datenschutz im Internet näherlegen soll und ihnen Verhaltensstrategien für den sicheren Umgang mit den sozialen Medien und anderen Nutzer*innen beibringen soll. Auch die Einheit „Realität und Fiktion in den Medien“ eignet sich gut, da sie sich unter anderem mit falschen Identitäten beschäftigt, die Leute im Internet zum Beispiel für Betrüge oder zum Herausfinden von persönlichen Daten nutzen können.
Zudem ist es wichtig, dass Lehrkräfte Schüler*innen dazu motivieren, im Unterricht erworbene Kompetenzen auf neue Sachverhalte zu transferieren und mit anderen Schüler*innen, Familienmitgliedern oder Bekannten darüber in den Austausch zu treten. Denn nur durch das Etablieren von nachhaltigen Transferinfrastrukturen und durch das stetige Lernen voneinander können Kompetenzen bedarfsgerecht und zukunftsträchtig vermittelt werden.
Um Kindern den Einstieg in die Internetnutzung zu erleichtern, hat das Deutsche Kinderhilfswerk in Kooperation mit der FSM, der Kindersuchmaschine fragFINN.de und O2 Telefónica das Magazin „Genial Digital“ entwickelt. Hier finden Kinder zwischen 8 und 11 Jahren Hilfe und spielerisch-interaktive Tipps, was sie bei Apps, Games und sozialen Netzwerken beachten sollten, wie sie mit privaten Daten umgehen, Fake News im Internet erkennen oder sich vor Cybermobbing schützen können.
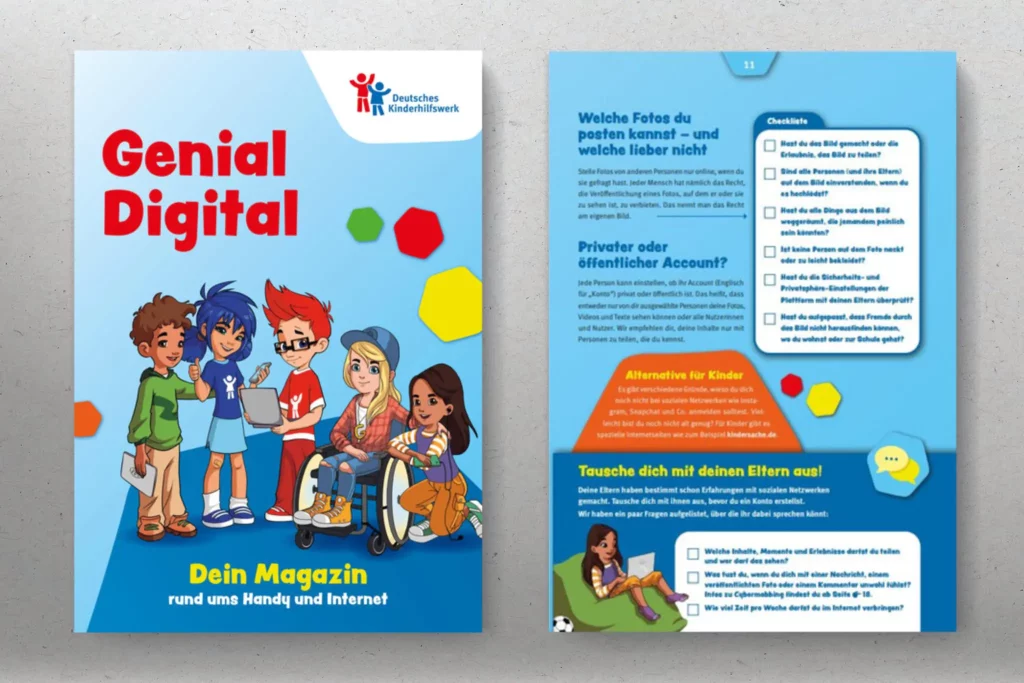
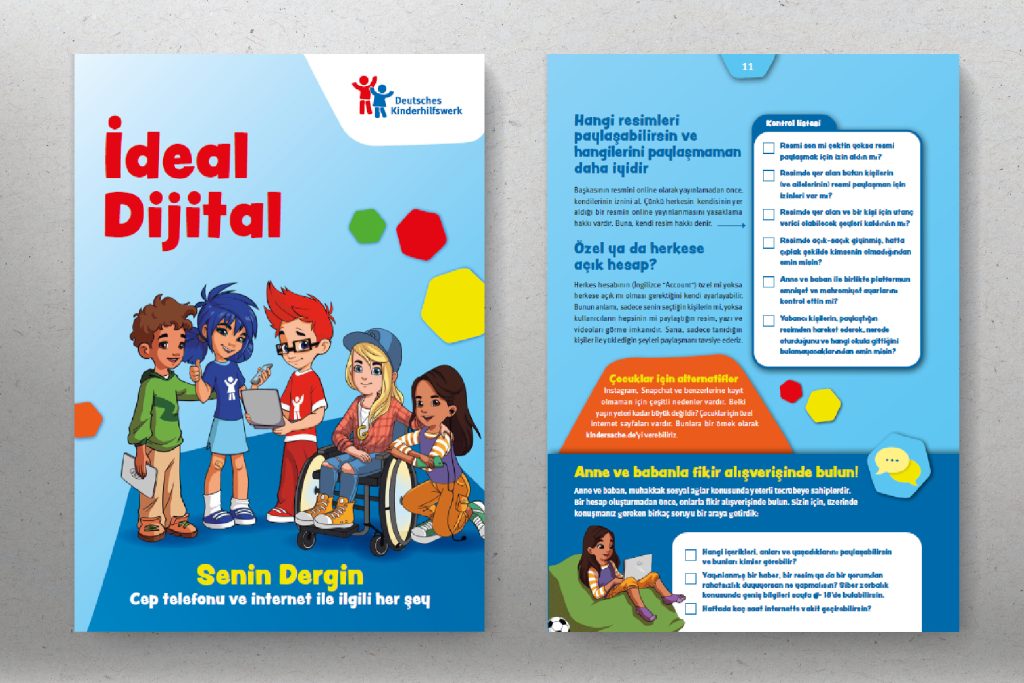
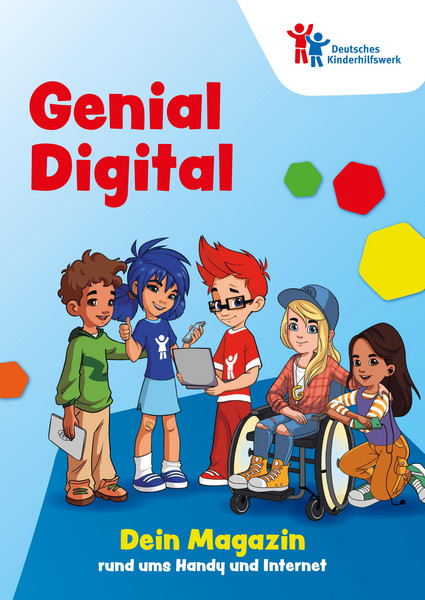
Wie richte ich mein erstes Smartphone ein? Was sind soziale Netzwerke und worauf sollte ich bei deren Nutzung achten? Warum ist der Schutz persönlicher Daten im Internet so wichtig? Was sind eigentlich Fake News, Cybermobbing oder Hassrede? Und wie gelingt ein gesunder Umgang mit digitalen Medien? Diese Fragen beantwortet das Magazin Genial Digital des Deutschen Kinderhilfswerkes. Es richtet sich an Kinder zwischen 8 und 11 Jahren und behandelt verschiedene Themen rund um das erste Smartphone und das Internet.
Das Magazin des Deutschen Kinderhilfswerk entstand in Kooperation mit der FSM, fragFINN.de und O2 Telefónica.
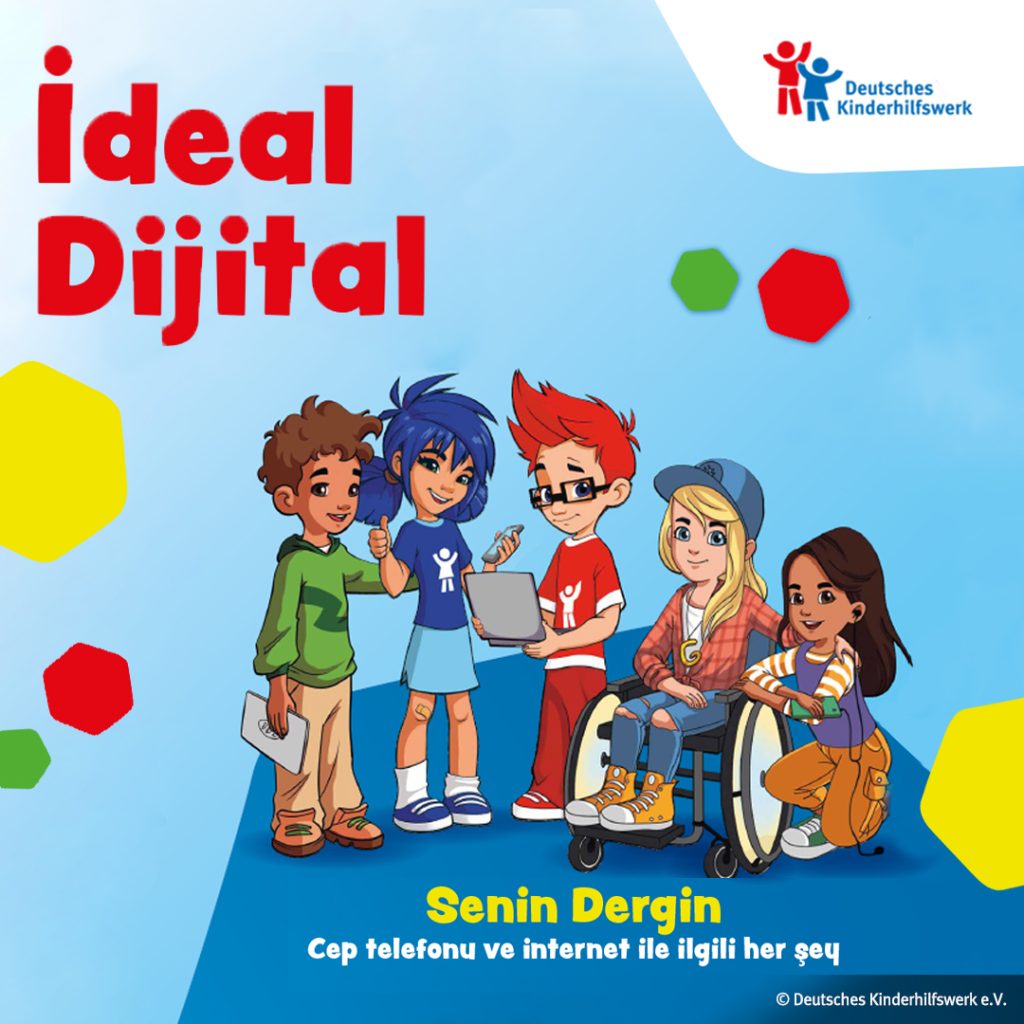
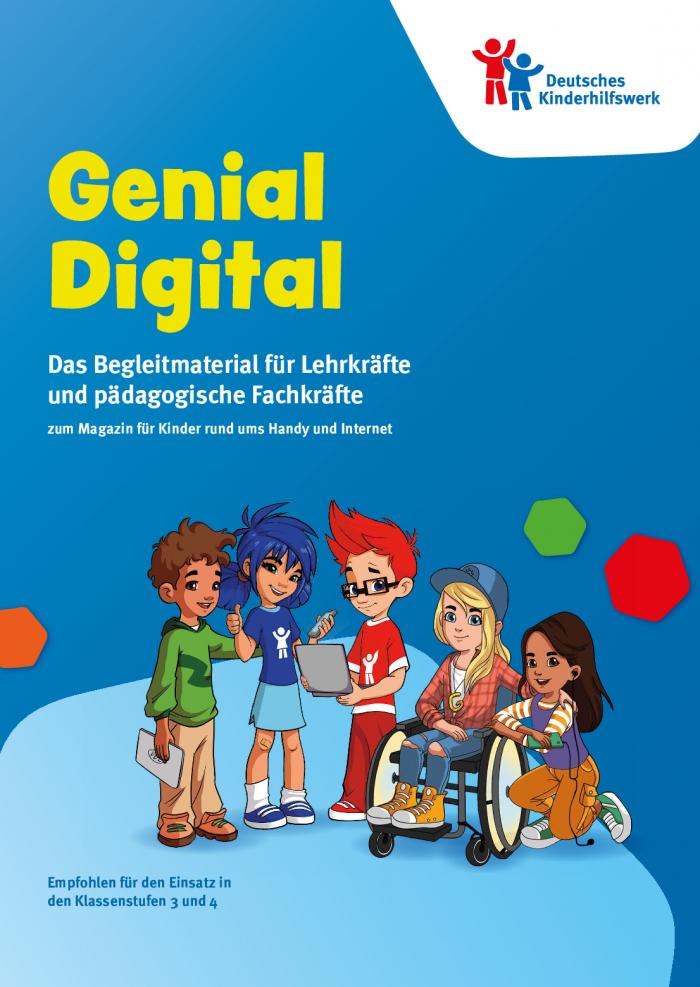
Ein zusätzlich entwickeltes Begleitmaterial gibt Lehr- und pädagogischen Fachkräften Impulse und Anregungen, wie sie das Magazin “Genial Digital” in Schule und Hort einsetzen können. Es steht zum kostenfreien Download als PDF zur Verfügung.
Die Schüler*innen vertiefen die Themen des Magazins rund um die sichere Nutzung von Smartphone und Internet. Die Unterrichtsvorschläge sind so ausgerichtet, dass die Schüler*innen die Übungen angeleitet oder frei erarbeiten können.
Insgesamt stehen vier Übungen zur Auswahl:
„Medien in die Schule“ veröffentlicht mit dem Material „Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung“ eine neue Unterrichtseinheit zur Bedeutung von digitalen Medien und dem Internet für die Lebenswelt von Jugendlichen. Entlang der Schwerpunktthemen persönliche Daten, Kommunikation im Netz, sicheres Suchen und Unterhaltung können Lehrkräfte Schüler*innen im Unterricht dabei unterstützen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.
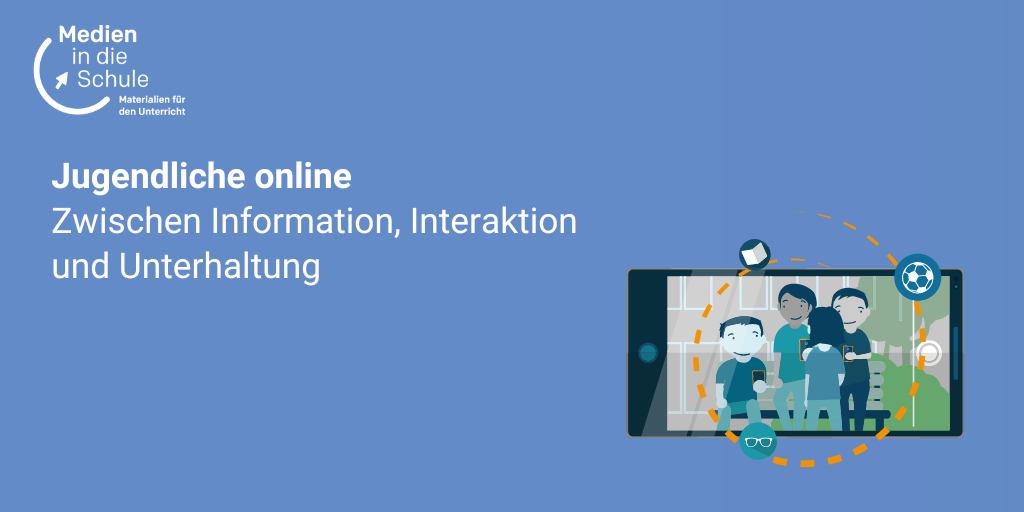
Unterrichtseinheit hier kostenlos herunterladen! Möchten Sie das Material als Druckversion kostenfrei bestellen? Melden Sie sich gern über unser Kontaktformular!
„Digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Jugendlichen. Freundschaften werden in den Sozialen Medien gepflegt, und Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern auch im Internet. Mit unserer neuen Unterrichtseinheit geben wir Lehrkräften Materialien an die Hand, um Medienkompetenz im Unterricht vielfältig zu stärken. Unser Ziel ist es, die diversen Aspekte der Onlinewelten von Jugendlichen auf den Stundenplan zu bringen. Junge Menschen können so ihre Kenntnisse im Unterricht vertiefen und bewusst reflektieren, wie sie digitale Medien nutzen. Denn selbstbestimmtes Handeln im Internet erfordert Wissen über Hintergründe und Zusammenhänge sowie konkrete Handlungsoptionen. „Medien in die Schule“ leistet somit einen aktiven Beitrag zur Medienkompetenzförderung von Jugendlichen.“
Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSM, Herausgeber von „Medien in die Schule“
Das Materialpaket ist in vier Module gegliedert, die jeweils – ausgehend vom eigenen Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen – relevante Inhalte der Onlinenutzung thematisieren und transparent machen. Ziel der Einheit ist es, Jugendliche zu befähigen, sich kompetent und selbstbestimmt in ihren Onlinewelten zu bewegen.
So unterstützt „Medien in die Schule“ Lehrende dabei, ihre Schüler*innen bei der Nutzung ihrer Leitmedien zu begleiten, sie für Gefahren zu sensibilisieren und ihnen Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln.
Das Unterrichtsmaterial „Jugendliche online. Zwischen Information, Interaktion und Unterhaltung“ ist Teil des Angebots von „Medien in die Schule“, das zahlreiche Inhalte und Themen der Medienbildung für den Lernraum Schule aufbereitet.
Bereits seit 2013 stellt das Gemeinschaftsprojekt der FSM und Google Zukunftswerkstatt in Kooperation mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen e.V. eine große Bandbreite an kostenfreien, offenen Unterrichtsmaterialien (OER) zu aktuellen medialen Erscheinungen zur Verfügung.
Lehrer*innen finden dort für die Sekundarstufen I und II aufbereitete Informationen, Materialien und praxisnahe Methoden rund um Themen wie z.B. die sichere Internetnutzung, Smartphones, Machine Learning, Hate Speech oder „Fake News“. „Medien in die Schule“ leistet so einen aktiven und praktischen Beitrag zur digitalen Bildung. Die Inhalte erhielten bereits mehrere positive Bewertungen durch den Materialkompass Verbraucherbildung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.
Die medienpädagogische Lernplattform MEDIENRADAR hat ein neues Dossier zum Thema „Daten & Privatsphäre – unsere digitalen Spuren“ veröffentlicht. Das Dossier widmet sich in Artikeln, Medienbeispielen und Interviews verschiedenen Fragen, u.a. nach digitalen Datenspuren, wie diese entstehen und genutzt werden, wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz in der Praxis umgesetzt werden oder welche Herausforderungen für Jugendliche mit ihren digitalen Lebenswelten bezüglich Datensouveränität und Privatsphäre bestehen. Es möchte mithilfe der Lehrmaterialien Anreize zur Bearbeitung des Themas im Unterricht schaffen.
Überall hinterlassen wir Datenspuren. Während im Jahr 2017 jeder Mensch im Durchschnitt täglich über 600 Megabyte an digitalen Daten erzeugte, sind es heute mehr als ein Gigabyte pro Tag. Und während bis Ende der 80er-Jahre noch weniger als ein Prozent aller Daten digital verfügbar waren, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt und nur noch 1 Prozent aller Daten sind analog vorhanden. Bis zum Jahr 2025 soll diese Menge an digital verfügbaren Daten nochmal um mehr als das fünffache steigen (Quelle: wirtschaftsforum.de).
Ein Großteil der Datenmengen wird ganz beiläufig von uns selbst produziert: wenn wir Suchmaschinen im Internet nutzen, in sozialen Netzwerken kommunizieren, Kredit- oder Kundenkarten verwenden, E-Mails versenden, unsere Standortdaten veröffentlichen oder im Internet shoppen. Unternehmen speichern und nutzen diese Daten, um daraus wertvolle Nutzer:innenprofile zu erstellen oder sie an andere Firmen zu verkaufen.
Damit das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder der Datenschutz davon nicht beeinträchtigt werden, wird in sämtlichen Verträgen und AGBs zwar detailliert beschrieben, welche personenbezogenen Daten über uns gespeichert und zu welchem Zweck sie verarbeitet werden, aber diese durchzulesen und zu verstehen, ist oftmals sehr mühsam. Hier den Überblick zu behalten, ist für den:die Einzelne:n kaum noch möglich. Noch undurchsichtiger wird die Kontrolle der eigenen Daten beim Thema staatlicher oder privater Überwachung als Mittel für mehr Sicherheit in der Gesellschaft.
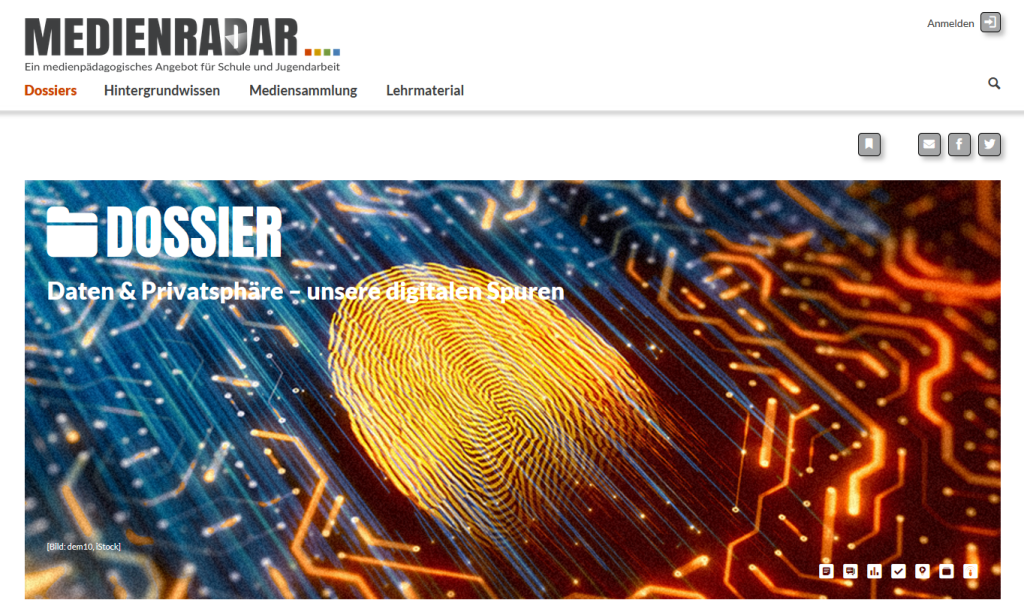
Doch was genau bedeutet das für uns? Wie können wir verstehen, wo diese ganzen Daten über uns gespeichert werden und mit welchen Absichten? Bezahlen wir im Netz inzwischen tatsächlich mit unseren Daten? Was kann passieren, wenn sensible Daten in die Hände Unbefugter kommen? Und wie unterscheidet man überhaupt sensible von weniger sensiblen Daten? Vor welchen Herausforderungen stehen insbesondere Jugendliche, die nur schwer auf die verlockenden digitalen Angebote verzichten können, sofern sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten? Und wie kann es gelingen, die eigene Datensouveränität und Privatsphäre ein Stück weit wiederzuerlangen?
Zum Dossier Daten & Privatsphäre – unsere digitalen Spuren
MEDIENRADAR ist ein Projekt der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). Der Aufbau des Angebotes wurde durch die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb gefördert. Partner*innen des Projekts sind die Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz, die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und das JFF – Institut für Medienpädagogik in Theorie und Praxis.
Als medienpädagogisches Portal richtet sich MEDIENRADAR an Fachkräfte in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit und bereitet aktuelle Medienthemen auf, die die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen unmittelbar berühren. Das thematisch passende Lehrmaterial ergänzt die Inhalte und kann flexibel in der pädagogischen Bildungsarbeit eingesetzt werden. Die Dossiers behandeln unterschiedliche Schwerpunktthemen und setzen sich aus den Bereichen Hintergrundwissen, Lehrmaterial und Mediensammlung zusammen.