Das vergangene Digitalcafé „Umgang mit Fake News und Hassrede: Medienkompetenz als Demokratiekompetenz“ des Kompetenznetzwerks Demokratiebildung im Jugendalter zog über 80 Teilnehmende aus der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit an. Bei der Veranstaltung hielt Lidia de Reese, Referentin für Medienbildung bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter (FSM e.V.) zuerst einen Impulsvortrag über Desinformation und Hassrede. Darin erklärte sie, wie Desinformation verbreitet wird, Inhalte manipuliert werden und auf welche Rhetoriken Täter*innen zurückgreifen, wenn sie Hate Speech gezielt gegen bestimmte Personen oder Menschengruppen richten. Es ist wichtig, dass Lehr- und Fachkräfte sich mit diesen Problematiken vertraut machen: Laut der JIM-Studie 2023 treffen 58 Prozent aller Jugendlichen und junger Erwachsenen im Monat auf Desinformation im Internet und über ein Drittel begegnet ebenso häufig Hassrede.
In ihrem Vortrag betonte de Reese, wie wichtig es sei, mit Jugendlichen ins Gespräch über Desinformation und Hassrede zu treten. Dabei spielen sowohl Prebunking, die präventive Sensibilisierung für kritische Inhalte, als auch Debunking, die Richtigstellung und Aufklärung von Fake News und Hate Speech, eine bedeutende Rolle. Dazu wurden praktische Tools und Materialien vorgestellt, welche sich leicht in den Unterricht integrieren lassen und interaktiv als Spiel oder Quiz die Medienkompetenz von Schüler*innen stärken. Auch wurde hervorgehoben, dass viele verschiedene Faktoren bei der Meinungsbildung eine Rolle spielen und dass man andere Meinungen aushalten können muss, solange diese sich im demokratischen Spektrum befinden, und diskutieren können muss. Lehrkräfte sollten Jugendliche dementsprechend auf ihre Ablehnung gegenüber bestimmten Meinungen oder journalistischen Beiträgen ansprechen, die Gründe dafür herausfinden und sie auf Alternativen, sowie auf mögliche Filterblasen, in denen sie feststecken könnten, hinweisen. Oft hilft es auch, in den Austausch mit den Eltern zu treten, da diese häufig Einfluss auf die Meinungsbildung ihrer Kinder haben. Unterstützende Ressourcen und Anlaufstellen für die Elternarbeit und den Unterricht wurden in einem TaskCards Board für die spätere Nutzung gesammelt.
Abschließend tauschte man sich in Kleingruppen dazu aus, welche Themen und Probleme die Pädagog*innen derzeit besonders beschäftigen und welche offenen Fragen zu Desinformation, Hassrede und dem Umgang damit noch bestünden. Die Antworten auf einige dieser Fragen, beispielsweise wie man sein Debunking möglichst effektiv verpackt oder wie man Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ihrer Filterblase helfen kann, finden Sie in diesem Resümee des Digitalcafés zum Nachlesen wieder.
Am 9. Juni fanden in Deutschland die Europawahlen 2024 statt. Insgesamt durften 4,8 Millionen Erstwähler*innen an der Wahl teilnehmen, über eine Million mehr als im Vorjahr. Das ist dadurch zu erklären, dass mit der Absenkung des Wahlalters zum ersten Mal ab 16-Jährige wählen durften. Auch bei den Landtagswahlen am 22. September in Brandenburg darf ab 16 gewählt werden. Dies ist eine bedeutende Neuerung, denn auch Jugendliche sind von gegenwärtigen politischen Entscheidungen betroffen und haben somit ein legitimes Interesse daran, mitbestimmen zu dürfen.
Besonders Desinformation und Verschwörungserzählungen werden jedoch von bestimmten Akteuren online eingesetzt, um Verwirrung und Unruhe zu stiften, gesellschaftliche Spaltungen zu bewirken und ihre eigenen politischen Interessen durchzusetzen. Dabei können jene Falschinformationen viele verschiedene Formen annehmen: Deepfakes und anderweitig manipulierte Fotos von Politiker*innen, Posts mit falschen Informationen zu den Wahlen, verfälschte Screenshots von Nachrichtenschlagzeilen und vieles mehr. Solche Inhalte können sich online rasant verbreiten und den politischen Diskurs stark polarisieren und die Wahlen delegitimieren, was die Demokratie gefährden kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Kinder und Jugendliche für jegliche Art von Desinformation sensibilisiert werden, damit sie Fakten von Fakes unterscheiden und verstehen können, mit welchem Ziel Desinformation verbreitet wird. Mehr dazu, wie sich Desinformation auf die Demokratie auswirkt finden Sie im weitklick-Beitrag „Wie gefährdet Desinformation die Demokratie?“.
Während des Wahlkampfes kursieren überall, vor allem in den sozialen Medien, widersprüchliche Informationen. Die erste Anlaufstelle für Fragen zur Wahl selbst sollte dabei immer die offizielle Webseite der Europawahlen sein. Dort lässt sich leicht herausfinden, wann die Wahlen in Deutschland stattfinden, wer wahlberechtigt ist, wie man sein Wahllokal findet und was man zum Wählen mitbringen muss. Die Seite ist auch in englischer Sprache verfügbar und es gibt auch ein zweisprachiges Angebot in Leichter Sprache auf Deutsch und auf Englisch.
Auch unabhängige Faktencheck-Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Überprüfung und Widerlegung von Desinformation. Es ist immer eine gute Idee, Informationen über mehrere Quellen zu prüfen und im Zweifelsfall auf einen Faktenchecker zurückzugreifen. Hier ist eine Auswahl an hilfreichen Faktencheckern für die Wahl:
Ebenso wichtig ist es, dass Schulen und andere Bildungseinrichtungen sich dafür einsetzen, die Medienkompetenz junger Menschen zu stärken und ihr kritisches Denken zu fördern. Denn nur so können Kinder und Jugendliche vertrauenswürdige und unseriöse Quellen voneinander unterscheiden und sich selbstständig eine eigene politische Meinung bilden. Angebote wie der faktenstark Trust-O-Mat oder der Newstest können Kinder und Jugendliche darauf aufmerksam machen, wie anfällig auch sie für Desinformation sein können und mit welchen Strategien sie diese in Zukunft besser handhaben können.
Auch die folgenden Angebote können dabei helfen, die Themen Desinformation und Verschwörungserzählungen generell und spezifisch im Kontext der Europawahlen im Unterricht zu beleuchten:
Es ist die Aufgabe aller Lehrkräfte, ihre Schüler*innen so gut wie möglich auf ihrem Bildungsweg und bei ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Dazu zählt jedoch nicht nur die Schulung in den klassischen Fächern wie Deutsch, Mathematik oder Englisch, sondern auch der Erwerb weiterer wichtiger Kompetenzen. Mit der rasanten Digitalisierung wird besonders die Medienbildung ein immer bedeutender Teil jener Kompetenzvermittlung.
Allerdings fällt es oft schwer, angemessene Unterrichtsmaterialien für junge Menschen mit Einschränkungen beim Lesen und Verstehen zu finden. Um allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu wichtigen Informationen und Bildungsinhalten zu ermöglichen, müssen deswegen Angebote in leicht verständlicher Sprache her. Diese fördern die Inklusion und Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an der digitalen Gesellschaft und ermöglichen es ihnen, sich sicher und selbstbewusst im Internet zu bewegen. Deswegen haben wir für Sie kostenlose Arbeitsblätter, Erklärtexte, Broschüren und vieles mehr in Leichter Sprache zu den Themenfeldern Jugendmedienschutz und Medienpädagogik gesammelt, um die Förderung der digitalen Kompetenzen aller Schüler*innen zu erleichtern.
Für den Einstieg in die Medienbildung und die Aneignung erster Kenntnisse ist es oft hilfreich, zentrale Begriffe wie Medien, Digitalisierung oder soziale Netzwerke nachschlagen zu können. Die folgenden Angebote bieten kurze, leicht verständliche Begriffsdefinitionen und längere Erklärtexte in vereinfachter Sprache, um grundlegende Fragen wie „Was ist ein Computer?“ oder „Was kann ich mit einem Smartphone alles machen?“ zu klären.
Umfangreichere Unterrichtseinheiten aus beispielsweise Arbeitsblättern, Broschüren, Stundenablaufplänen und Videos hingegen eignen sich, um Themen zu vertiefen und zu festigen. Die hier vorgestellten Materialien thematisieren verschiedenste medienpädagogische Schwerpunkte, wie Cybermobbing, Desinformation und Extremismus, aber auch die Rolle von Influencer*innen, Geschlechterstereotypen in Musikvideos und Datenschutz. Einige wurden fächer- oder altersspezifisch konzipiert, während andere frei in allen Klassenstufen und Fächern eingesetzt werden können, soweit gewünscht.
Für Eltern stellt Elternguide.online zusätzlich Texte in Leichter Sprache zu Verfügung. Sie sollen dabei helfen, den richtigen Medieneinsatz für verschiedene Altersklassen einzuschätzen und welche Angebote und Geräte sich für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Lebensphasen eignen.
Gerüchteküche oder Informationsquelle? – Eine neue Unterrichtseinheit des DsiN-Projekts DigiBitS – Digitale Bildung trifft Schule unterstützt Lehrkräfte bei der Sensibilisierung für Verschwörungserzählungen. Sie wurde in Kooperation mit den Projekten Medien in die Schule und weitklick entwickelt.
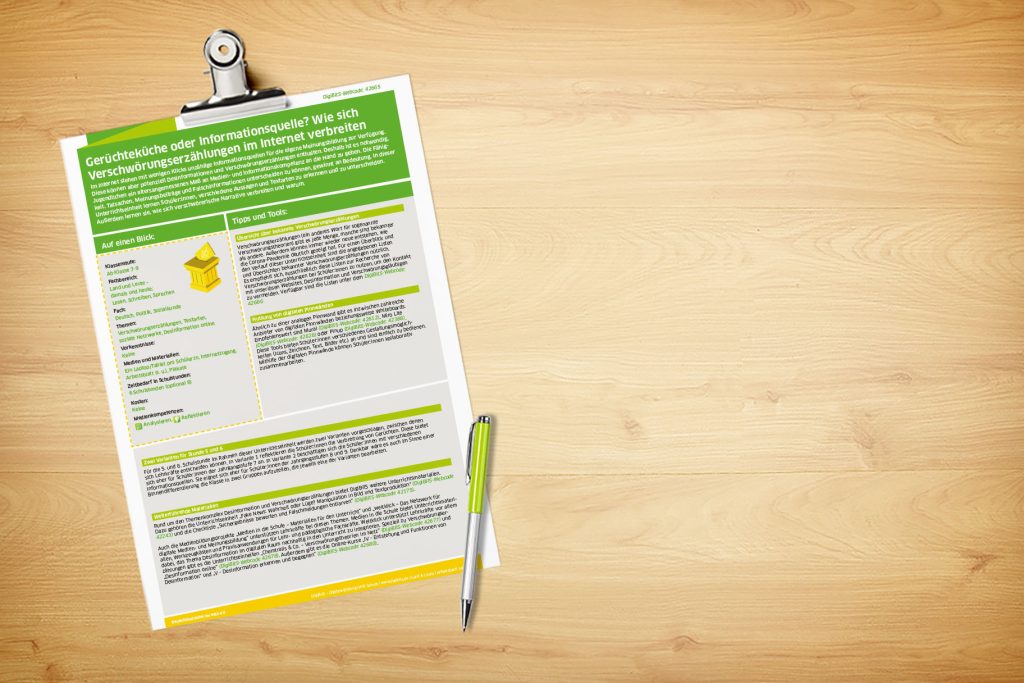
Verschwörungserzählungen gibt es schon lange. Seit der Covid-19-Pandemie gelangen sie aber vermehrt in den öffentlichen Diskurs. Besonders kritisch ist ihre Verbreitung in sozialen Netzwerken, in denen sich auch Jugendliche aufhalten und sich dadurch verunsichert fühlen. Dies ist Grund genug im Schulunterricht über verschwörerische Narrative, deren Charakteristika und Verbreitungswege ins Gespräch zu kommen. Mithilfe der neuen Unterrichtseinheit können Lehrkräfte ihre Schüler*innen für das Thema sensibilisieren und so die Informations- und Medienkompetenz junger Menschen stärken.
Die Unterrichtseinheit ist das Ergebnis einer Kooperation mit den beiden Medienbildungsprojekten „Medien in die Schule – Materialien für den Unterricht“ und „weitklick – Das Netzwerk für digitale Medien- und Meinungsbildung“ von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V.
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit verschiedenen Textarten und lernen, sie voneinander abzugrenzen. Ziel ist es, Meinungen von Fakten abzugrenzen. Auch die Verbreitungswege von Verschwörungserzählungen sind Thema der Unterrichtseinheit. Optional können Lehrkräfte ein Gedankenexperiment mit ihren Schüler:innen ausprobieren, dass ihnen die gesellschaftliche Sprengkraft von Verschwörungserzählungen verdeutlicht.
Kostenfreier Download der Unterrichtseinheit: Gerüchteküche oder Informationsquelle? Wie sich Verschwörungserzählungen im Internet verbreiten
Die neue Unterrichtseinheit ergänzt weitere DigiBitS-Unterrichtsmaterialien zum Thema:
Bei Medien in die Schule finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien, Werkzeugkästen und Praxisanwendungen für den Einsatz im Unterricht. Speziell zu Thema Verschwörungserzählungen stehen innerhalb des Unterrichtsmaterials Meinung im Netz gestalten zwei Module zur Verfügung:
Das Fortbildungsprogramm „weitklick“ unterstützt Lehrkräfte dabei, das Thema Desinformation im digitalen Raum nachhaltig in den Unterricht zu integrieren. Passend zu Thema empfehlen wir insbesondere die Online-Kurse zum Selbstlernen „Kurs IV – Entstehung und Funktionen von Desinformation“ und „Kurs V – Desinformation erkennen und begegnen“.