Im Jahr 1998 rief der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest das Pendant der KIM-Studie für Jugendliche, die JIM-Studie, ins Leben. Seitdem befragt der Verbund jährlich ca. 1.200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren aus ganz Deutschland zu ihrem Medienalltag. Dabei wird primär die Nutzung und der Konsum verschiedener Medien in der Freizeit gemessen, jedoch werden auch die Rezeption von Nachrichten und Informationen, die persönliche Wahrnehmung von Desinformation und der Medieneinsatz in der Schule erfasst.
In 2023 wurde darüber hinaus ein besonderer Fokus auf die Eindrücke und Empfindungen von Schüler*innen gegenüber dem Einsatz von digitalen Tools wie Schulmessengern und Schulclouds gelegt. Auch wurde zum ersten Mal erfasst, wie stark Jugendliche gegen ihren Willen pornografischen Inhalten ausgesetzt werden und wie prävalent sexuelle Belästigung im Netz ist.
Auch im vergangenen Jahr ist der Medienkonsum der Jugendlichen erneut rundum angestiegen, jedoch bleiben Aktivitäten wie sich mit Freunden treffen, Sport treiben oder etwas mit der Familie unternehmen weiterhin beliebt. Allerdings verbringen mittlerweile 93% der Jugendlichen täglich Zeit am Handy und verzeichnen damit eine durchschnittliche Bildschirmzeit am Smartphone von 213 Minuten pro Tag. 43% aller Jugendlicher sind sich ihrer Bildschirmzeit jedoch bewusst und achten aktiv darauf, ihre Zeit am Smartphone in Grenzen zu halten. Knapp über die Hälfte genießen es auch, regelmäßig Zeit offline zu verbringen und die Mehrheit hält das Handy für einen Zeitfresser.
Unabhängig vom Gerät sind Jugendliche derzeit im Schnitt 224 Minuten pro Tag im Internet unterwegs. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 204 Minuten. Social Media Apps wie WhatsApp, Instagram und TikTok sind dabei besonders populär. Aber nicht nur unterhaltende Beiträge werden auf diesen Plattformen rezipiert, sondern sie dienen mittlerweile auch als wichtige Informationsquelle: Etwa ein Drittel aller Jugendlicher informiert sich auf YouTube, TikTok oder Instagram zum aktuellen Weltgeschehen. Als besonders interessant werden dabei die Themen Klimawandel (63%), Ukraine-Krieg (54%) und Diversity/Vielfalt (40%) betrachtet. Damit stehen die sozialen Medien an vierter Stelle der Informationsquellen hinter dem Gespräch mit Familienmitgliedern, Nachrichten aus dem klassischen Fernsehen oder Radio und dem Gespräch mit Freunden. Zusätzlich haben 39% mindestens eine Nachrichtenapp installiert und zwei Drittel halten sich selbst für gut informiert.
Allerdings begegnen mit der steigenden Nutzung von sozialen Netzwerken auch immer mehr Jugendliche Desinformation und Beleidigungen im Netz. Über die Hälfte ist schon einmal mit Fake News und beleidigenden Kommentaren in Berührung gekommen und extreme politische Ansichten, Verschwörungserzählungen und Hassbotschaften liegen mit ca. 40% nicht weit dahinter. 14% wurden selbst schon einmal Opfer von Beleidigungen. Schüler*innen müssen deswegen stärker für diese Phänomene sensibilisiert werden und lernen, Desinformation zu erkennen und extremistischen Meinungen zu begegnen. Die Unterrichtseinheit „Hass in der Demokratie begegnen“ von Medien in die Schule eignet sich dazu, da sie Jugendliche altersgerecht über Rechtsextremismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Hate Speech aufklärt.
Auch wurden 2023 zum ersten Mal der Kontakt zu pornografischen Inhalten erfasst, welchen 23% aller Jugendlichen schon einmal unfreiwillig ausgesetzt wurden. Fast ein Drittel ist zudem bereits selbst sexuell belästigt worden, 6% der Betroffenen passiert dies sogar mehrmals pro Woche. Mädchen sind dabei mit einem Unterschied von 12 Prozentpunkten deutlich häufiger betroffen als Jungen. Meistens finden solche sexuellen Belästigungen auf Instagram (35%), TikTok (20%) oder Snapchat (14%) statt. Jugendliche müssen vor solchen Situationen geschützt werden und sie müssen, darin unterstützt werden, problematische Inhalte und Situationen selbst zu erkennen. Die Module „Persönliche Daten“ und „Identitäten und Profile: Jeder kann Jeder sein?“ helfen Jugendlichen dabei, ihre persönlichen Informationen im Internet privat zu halten und Profile von potenziell böswilligen Personen zu erkennen. Das Modul „Erscheinungsformen problematischer Inhalte und Verhaltensweisen im Netz“ der Einheit Jugendliche online hingegen bringt ihnen bei, kritische Situationen im Internet auszumachen und angemessen darauf zu reagieren.
63% aller Schüler*innen zwischen 12 und 19 Jahren gehen regelmäßig im Unterricht online. Am häufigsten werden dabei Tablets (39%), Smartphones (35%), Smartboards (26%) und Laptops (21%) genutzt. Durch die Corona-Pandemie und den vermehrten Einsatz von Tools wie Schulmessengern, Schulclouds und Online-Meetings verschwimmt die Linie zwischen Schule und Freizeit immer mehr. 79% aller Schüler*innen geben an, einen Schulmessenger zu nutzen und 31% haben dadurch das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen. 30% können deshalb nicht richtig von der Schule abschalten und 24% fühlen sich deswegen gestresst. Jeder Fünfte verliert dadurch auch den Überblick über die eigenen Aufgaben und fühlt sich technisch überfordert. Aufgrund dessen ist es wichtig, dass Lehrkräfte sich dieses Stressfaktors bewusst sind und die Präferenzen und Sorgen der Schüler*innen beachtet werden.
Das Modul „Deine Meinung zum Thema »Onlinekommunikation«“ hilft dabei, ins Gespräch zu treten und Schüler*innen den Freiraum zu lassen, offen über Kommunikation im Netz und ihre eigenen Empfindungen zu reden. Dabei können mithilfe des Moduls „Für ein respektvolles Miteinander: Regeln für den Gruppen-/Klassenchat“ Regeln ausgehandelt werden, die den Kontakt über Schulmessenger und in Klassenchats nicht nur zwischen Lehrkräften und Schüler*innen, sondern auch zwischen Klassenkameraden einschränken und ein angenehmes Klassenklima gewährleisten.
Die Hälfte aller deutscher Internetnutzer*innen wurden schon einmal mit Hass im Netz konfrontiert, so lautet ein Ergebnis der neusten Studie „Lauter Hass, leiser Rückzug“ des Kompetenznetzwerks Hass im Netz. Mehr als 3.000 Teilnehmer*innen ab 16 Jahren wurden in der Studie zu ihrer eigenen Wahrnehmung und ihren Erfahrungen mit Hass im Netz befragt. Besonders stach dabei hervor, dass Jugendliche überdurchschnittlich oft Kontakt zu hasserfüllten Inhalten hatten, dreimal so viel wie die älteste erfasste Altersgruppe. Auch wurde beleuchtet, wie Jugendliche auf problematische Situationen reagieren und Hilfestellung leisten, welche Folgen Betroffene mit sich tragen und welche Wünsche und Ansprüche an das Bildungswesen Nutzer*innen stellen.
69 Prozent aller Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter von 16 bis 24 Jahren haben schon einmal selbst Hass im Netz gesehen; über ein Viertel hat sich sogar selbst als Ziel solcher Kommentare wiedergefunden. Frauen und Personen, die einer Minderheit angehören, kommen dabei überproportional oft mit Hass in Berührung. Frauen, Personen mit nicht heterosexueller Orientierung und Personen mit Migrationshintergrund, vor allem mit sichtbarem Migrationshintergrund, erfahren im Schnitt mindestens 10 Prozent mehr Hass als andere Bevölkerungsgruppen. Zudem nehmen junge Menschen auch Politiker*innen (60%), Geflüchtete (58%), Aktivist*innen (54%) und religiöse Gruppen wie Muslime (45%) und Juden (31%) als häufige Ziele für aggressive und abwertende Aussagen wahr.
Häufig richten sich hasserfüllte Beiträge daneben gegen die politischen Ansichten, das Aussehen und die körperliche und psychische Gesundheit der Betroffenen. Betroffene berichten vor allem von Beleidigungen als verbreitetster Hassakt, gefolgt von der Verbreitung von Falschinformationen über einen selbst, sexueller Belästigung, unter anderem durch das Zuschicken von Nacktfotos oder Dickpics, und Bedrohung und Doxing. Frauen werden dabei weitaus häufiger Opfer sexualisierter Gewalt und erhalten fast doppelt so häufig ungefragt Nacktbilder, während Männer eher physische Gewaltandrohungen zugestellt bekommen.
X (früher: Twitter) wird von der Hälfte der Befragten als häufigster Schauplatz für Hass genannt. Knapp dahinter befinden sich TikTok (47%), Facebook (41%) und Instagram (38%). Messenger-Dienste wie WhatsApp werden hingegen eher selten benannt, mit der Ausnahme von Telegram, welcher häufiger nicht im privaten Kreis, sondern für seine öffentlichen Channels genutzt wird. Gleichzeitig nennt über die Hälfte der Befragten X, TikTok, Facebook und Instagram allerdings auch als Plattformen mit den leichtesten Meldewegen, während besonders Messenger-Dienste und Gaming-Plattformen eher schlecht abschneiden.
Dennoch greifen die meisten Jugendlichen zu passiveren Umgangsformen mit Hass wie das Blockieren und Stummschalten von Hassverbreitern (46%), das Privatstellen des eigenen Profils (40%) und dem Ignorieren von Kommentaren (36%). Betroffene sind hingegen öfter proaktiver: Drei Viertel melden den Plattformen Hass und zwei Drittel äußern sich kritisch gegenüber solchen Beiträgen und Kommentaren. Etwas weniger als die Hälfte zieht sich jedoch als Antwort auf Hass im Netz komplett sozial zurück und berichtet von psychischen Beschwerden (35%), Problemen mit dem Selbstbild (35%) und einem Rückgang der Online-Aktivität (34%). Fast die Hälfte deaktiviert und löscht ihr Profil daraufhin oder hört auf, auf der Plattform zu posten. Hilfsangebote dritter Parteien wie Meldestellen, Beratungsstellen oder der Polizei werden hingegen von allen Nutzer*innen wenig genutzt.
Die Mehrheit der Befragten macht sich Sorgen, dass andere sich durch Hass im Netz eingeschüchtert fühlen und weniger an Diskussionen teilnehmen, sich seltener zu ihrer eigenen politischen Meinung bekennen oder das Gefühl haben, sie müssen ihre Beiträge bewusst vorsichtiger formulieren. Vor allem Frauen, junge Erwachsene und Minderheiten bekennen sich dazu, sich von Onlinediskussionen ausgeschlossen zu fühlen. Dadurch werden sie bei politischen Debatten und bei der Meinungsbildung benachteiligt.
Deswegen fordern 84 Prozent aller Befragten, dass Hass im Netz im Unterricht stärker behandelt und fest in Lehrplänen verankert werden sollte. Sie verlangen mehr und umfangreichere Fortbildungen für Pädagog*innen und eine stärkere finanzielle Förderung von Projekten aus der Medienbildung.
Projekte wie Medien in die Schule sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, gemeinsam mit ihren Schüler*innen Themen wie Hass im Netz und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft zu behandeln sowie Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten zu erlernen.
Eine Auswahl an hilfreichen weiterführenden Materialien zum Thema „Hass im Netz“ finden Sie hier:
Auch im vergangenen Jahr haben sich die Medienanstalten mit dem Einfluss verschiedener Medien auf die Meinungsbildung in Deutschland befasst. Dazu wurde der Medienalltag von 1.412 Studienteilnehmenden ab 14 Jahren im Rahmen der Mediengewichtungsstudie 2023 erfasst und ausgewertet. Berücksichtigt wurden dabei die Mediengattungen Fernsehen, Radio, Internet, Zeitung, Zeitschrift und Magazin.
Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Auswertung auf die Funktion von Intermediären wie sozialer Netzwerke bei der Verbreitung von Informationen gelegt. Vor allem Kinder und Jugendliche haben oft Probleme damit, wahre von verfälschten Inhalten zu unterscheiden und die Legitimität von Anbietern einzuschätzen, sind jedoch gleichzeitig besonders im Internet einer andauernden, stetig wachsenden Flut an Desinformation und Verschwörungserzählungen ausgesetzt. Es ist deswegen wichtig, die Reichweite solcher digitaler Angebote einzuschätzen, um Minderjährige auf künftige Herausforderungen vorbereiten zu können.
Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau von 2019 ist die Mediennutzung für informative Zwecke im letzten Jahr etwas angestiegen. Insgesamt gaben 81,4 Prozent aller 14- bis 29-Jährigen an, Medien täglich für die Informationssuche zu verwenden. An erster Stelle stand dabei das Internet, welches von knapp über der Hälfte jeden Tag für Informationen genutzt wird, und übertraf damit erstmalig das Fernsehen als dominanteste Informationsquelle. Bei den jüngeren erfassten Altersgruppen betrug dieser Wert sogar bis zu 70,9 Prozent. Auch messen Jugendliche dem Internet deutlich mehr Bedeutung bei der Informationssuche bei als Erwachsene. Aber auch klassische Angebote wie das Fernsehen, Tageszeitungen und das Radio werden weiterhin von ihnen genutzt.
Die Angebote klassischer Anbieter bleiben im Internet jedoch weiterhin beliebt: mit 30,8 Prozent liegen sie auf dem 2. Platz der wichtigsten Info-Touchpoints für Jugendliche, hinter originären Onlineangeboten. Auch die sozialen Medien, Internetangebote und Angebote des Rundfunks werden von dieser Altersgruppe als bedeutend für den Informationskonsum erachtet.
Insgesamt ist die Nutzung von Intermediären im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Jedoch bleiben sie für den Informationszyklus weiterhin relevant. Während die Suchmaschine Google bei allen anderen Altersgruppen die höchste Tagesreichweite verzeichnete, zeigte sich Instagram mit beinahe einem Drittel aller Befragten als Sieger bei den unter 30-Jährigen. Google folgte mit etwas Abstand auf Platz 2 (26,1%), während YouTube (25,7%), TikTok (11,7%) und Facebook (8,1%) den Rest der Top 5 bekleideten.
Die sozialen Medien stechen damit noch vor anderen Onlineangeboten als wichtigste Informationslieferanten hervor. Allerdings nimmt die Mehrheit Nachrichten nur nebenher auf und nutzt die Plattformen primär für andere Zwecke wie der Unterhaltung oder Kommunikation mit Freund*innen und Familie. Nur für 10,5 Prozent sind Informationen der Hauptgrund für ihre Nutzung von sozialen Medien. Auch halten über die Hälfte die Informationen, die ihnen in ihrem Feed angezeigt werden, für ausreichend.
Dennoch hält knapp über ein Viertel die sozialen Medien für wichtige Nachrichtenquellen und nutzt diese täglich für solche Zwecke. Auch hat über ein Drittel mindestens ein Nachrichtenangebot auf einem oder mehreren der Netzwerke abonniert. Besonders beliebt sind dabei Angebote klassischer Medien (44,8%), eines Fernsehsenders (35,7%) und von Tageszeitungen (25,3%), aber auch von individuellen Content Creators wie privaten Nutzer*innen (26,1%) oder Blogger*innen, Influencer*innen und YouTuber*innen (23,3%). Diejenigen, die regelmäßig Nachrichten in den sozialen Medien rezipieren, lesen mehrheitlich auch weiterführende Informationen, Kommentare und Diskussionen zu diesen Beiträgen. Auch teilen 22,5 Prozent Artikel mit anderen und 20,6 Prozent nehmen selbst am Diskurs in der Kommentarsektion teil.
Problematisch ist allerdings die Anzahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich (fast) ausschließlich auf die sozialen Medien für ihre Nachrichten verlassen: 36,8 Prozent geben an, Informationen hauptsächlich oder sogar exklusiv über die sozialen Medien aufzunehmen. Zwar nutzen die meisten somit dennoch entweder soziale Medien und andere Quellen gleichermaßen oder präferieren sogar andere Informationsangebote, allerdings kann der relativ große Anteil, der nicht auf andere Quellen zurückgreift, nicht unbeachtet gelassen zu werden. Denn eine solche Einschränkung der Informationsquellen führt dazu, dass Informationen schwerer über verschiedene Quellen hinweg verifiziert werden können und kann zur Verbreitung von Desinformation beitragen.
Deswegen ist es wichtig, Jugendliche im Umgang mit verschiedenen Mediengattungen zu schulen und ihnen beizubringen, sich ihre Meinung auf der Basis von vielen unterschiedlichen Quellen zu bilden. Die folgenden Lehrmaterialien sollen Lehrkräfte dabei unterstützen, Schüler*innen im schulischen Kontext über Themen wie Desinformation, Meinungsbildung und Nachrichtenproduktion zu unterrichten:
Das Blended-Learning-Fortbildungsprogramm weitklick hat eine neue fünfteilige Videoreihe mit dem Titel „Mehr Durchblick mit…“ veröffentlicht. Die Videos sollen Kindern und Jugendlichen einen niederschwelligen Einstieg in das Themenfeld Desinformation und Hate Speech bieten. Denn gerade diese Altersgruppe ist laut der neusten JIM-Studie vermehrt einer Flut an Desinformation ausgesetzt und muss lernen, dieser zu begegnen.
In den Videos erklären Fachkräfte aus der Medienbranche anhand von Beispielen aus ihrer Berufspraxis, wie Desinformation und Hass in den Medien und auf Social Media aussehen können. Außerdem geben sie praktische Tipps zum Umgang mit beiden Phänomenen. Die Videos sind zwei bis vier Minuten lang und setzen kein Vorwissen voraus, weshalb sie sich für den Einsatz im Unterricht oder in außerschulischen Bildungsprojekten eignen. Sie empfehlen sich für Schüler*innen ab der 7. Klasse.
Die fünf Videos befassen sich mit unterschiedlichen Facetten von Desinformation und Hate Speech wie der Einschätzung der Seriosität von Quellen, dem Einsatz von KI bei der Verbreitung von Desinformation und dem Zusammenhang zwischen Desinformation und Hate Speech. Die Themen und Referent*innen sind im Detail hier aufgelistet:
Die Videos sind kosten- und werbefrei und können unter www.weitklick.de/videoreihe über YouTube gestreamt oder direkt heruntergeladen werden. Es stehen Untertitel auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch zur Verfügung.
Elternguide.online veranstaltet einen kostenlosen virtuellen Elternabend am 08.02.2024 zum Thema „Let’s talk about Porno: Wie Eltern Kinder und Jugendliche vor Pornografie und sexueller Gewalt online schützen sowie altersgerecht aufklären können“ mit Martin Bregenzer (klicksafe) und Sven Bischoff (FSM e.V.). Er findet von 17:00 bis 18:00 Uhr statt.
Viele Kinder und Jugendliche kommen im Netz schon früh in Kontakt mit Pornografie, zufällig und ohne Absicht genauso wie aus Neugierde und Interesse – auf Pornowebseiten, durch (ungewollte) Zusendung von pornografischen Inhalten in Gruppenchats oder auf Social Media. Das Sprechen über Sexualität und Pornografie in der Familie fällt jedoch nicht immer leicht. Was sagt das Gesetz, was bedeutet das Verbot von Pornografie für Kinder und Jugendliche in der Praxis? Was ist zu tun, wenn Kinder und Jugendliche trotzdem darauf stoßen? Welche Folgen hat Porno-Konsum eigentlich für Jugendliche? Welche Schutzmöglichkeiten gibt es?
Beim virtuellen Elternabend von Elternguide.online erhalten Sie Informationen und praktische Tipps, die Ihnen helfen, in der Familie über sexuelle Aufklärung und Pornografie zu sprechen. Unsere Experten stehen Ihnen bei und beantworten Ihre Fragen.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Safer Internet Day 2024 statt. Mehr über den Aktionstag erfahren Sie bei klicksafe.
Zur Anmeldung auf Elternguide.online
Moderation: FSM e.V.
Hinweis: Der virtuelle Elternabend findet per Zoom statt. Er ist kostenlos und offen für alle Interessierten! Dieser Elternabend wird weder gestreamt noch aufgezeichnet. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.
Die medienpädagogische Bildungsinitiative Media Smart e.V. hat eine neue Folge ihrer Reihe Media Snacks unter dem Titel “Influence is everywhere!“ Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation im Zeitalter von Social Media” veröffentlicht. Sowohl im Alltag als auch in der digitalen Welt sind wir ständig verschiedenen Botschaften ausgesetzt. Oft merken wir dabei selbst nicht, dass wir gerade beeinflusst werden, da wir Desinformation, von Algorithmen selektierte Inhalte oder versteckte Produktplatzierungen nicht immer sofort erkennen.
Genau darauf versucht das Projekt “Influence is everywhere!” aufmerksam zu machen. Das Bildungspaket ist darauf ausgelegt, jungen Menschen bei der Informationssuche und -verarbeitung zu helfen und ihnen beizubringen, beeinflussende Inhalte zu erkennen. Klassische Arbeitsblätter werden dabei mit interaktiven Unterrichtseinheiten und Interviews gekoppelt, um ein vielfältiges und ansprechendes Angebot für die Klassenstufen 6 bis 8 zu gestalten. Das Material ist fächerübergreifend und flexibel im z.B. Deutschunterricht oder der Gesellschaftslehre einsetzbar.
Im 1. Kapitel “Grundlagen der (Medien-)Sozialisation” werden digitale Interaktionen näher beleuchtet und kritisch betrachtet. Uns wird unsere eigene Rolle als Empfänger*innen vor Augen geführt und welche Arten von Beziehungen wir beim Konsum von Inhalten mit deren Sender*innen eingehen. Auch unser eigener Einfluss durch z.B. Kommentare im Internet auf das Verhalten und die Medienrezeption anderer wird verdeutlicht und wie Interaktionen im Netz sich rückwirkend wieder im analogen Leben bemerkbar machen.
Das 2. Kapitel “Ein kritischer Blick auf Informationen im Netz” fokussiert sich anschließend dazu auf die Macht von Falschnachrichten und Werbeplatzierungen auf Meinungsbildungsprozesse und die eigenen Emotionen. Im 3. Kapitel “Digitale Medien als Mutmacher” wird die positive Seite digitaler Medien thematisiert. Hier wird betont, dass Kanäle wie soziale Netzwerke selbstverständlich nicht nur für das Verbreiten böswilligen Gedankengutes und negativer Berichterstattung genutzt werden können, sondern junge Menschen auch zu Aktivismus und sozialem Engagement mobilisieren können. Im 4. Kapitel “Das Einmaleins der Informationskompetenz” werden Materialien und praxisbezogene Methoden bereitgestellt, wie Kinder und Jugendliche lernen können, kompetent mit Beiträgen in den sozialen Netzwerken und auf Nachrichtenseiten umzugehen, Quellen zu überprüfen und selbst zu recherchieren.
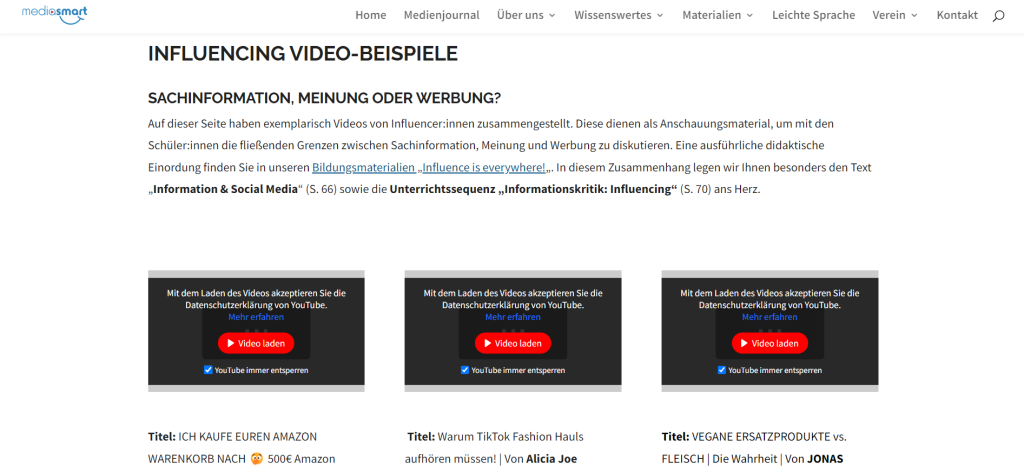
Die wachsende Informationsflut ist Teil des Lebens von Kindern und Jugendlichen und wird sie auch in Zukunft begleiten, kann auf sie aber überwältigend wirken. Deswegen wird es immer wichtiger, junge Menschen schon früh mit Kompetenzen auszustatten, auf die sie folglich ihr ganzes Leben lang zurückgreifen können. Dafür ist es jedoch wichtig, erst einmal ein Interesse für die Thematik aufzubauen, was mit den Unterrichtsentwürfen und Arbeitsmaterialien von Media Smarts erleichtert werden soll: Durch das vielfältige Angebot wird es Lehrkräften ermöglicht, jedes Kind individuell anzusprechen und ihnen die Schwerpunkte des Bildungspakets auf verschiedenste Weisen näher zu bringen.
Jeder Unterrichtsabschnitt wird von einem Erklärvideo begleitet und Erlerntes kann durch interaktive Quizze spielerisch gefestigt werden. Auch weiterführendes Material zur Analyse und als Anregung für Diskussionen wird bereitgestellt: Von einer Liste von Influencerbeiträgen, die es auf womöglich problematische oder hilfreiche Inhalte zu untersuchen gilt bis hin zu einem Interview mit der Klimaaktivistin Fabia Klein von Fridays for Future als Beispiel für die positiven Auswirkungen der sozialen Netzwerke auf das alltägliche Leben ist alles mit dabei. Lehrkräfte werden ebenfalls dabei unterstützt, in den Austausch mit Eltern zu treten und es wird zu einem dynamischen Dialog zwischen Schulen, Schüler*innen und Eltern angeregt.
Media Smart e.V. ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die die Medien- und Werbekompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert. Ihre Angebote setzen sich aus kostenfreien, medienpädagogischen Bildungsmaterialien wie den Media Snacks und Beiträgen rund um Medien und Werbung auf den sozialen Netzwerken zusammen.
Das Projekt “Influence is everywhere!” wurde durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) gefördert. Der Verein wird durch die Unternehmen Ad Alliance GmbH, Ferrero, Hasbro, LEGO, Mattel, MediaCom Agentur für Media-Beratung, Omnicom Media Group Germany (OMG) und SUPER RTL Fernsehen GmbH unterstützt.